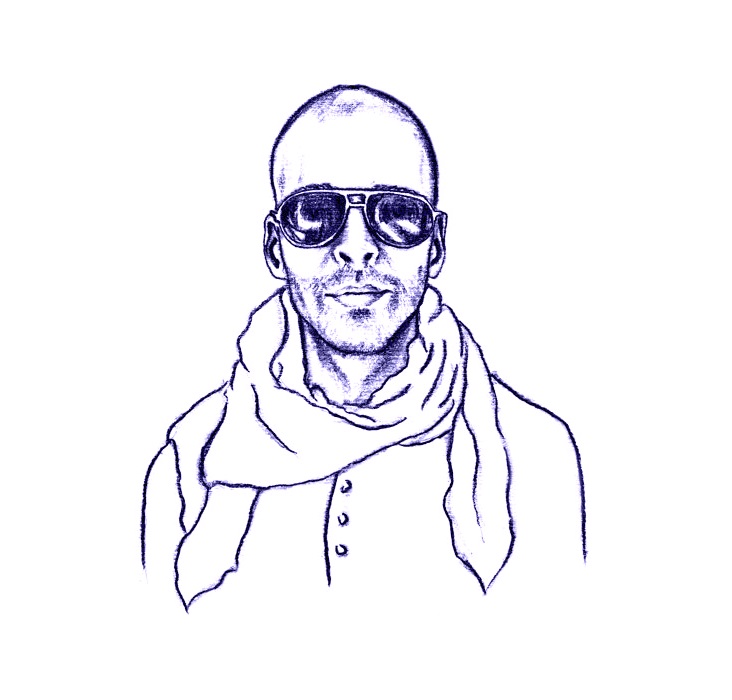Der Feldzug verloren, diplomatische Bemühungen gescheitert, Israel vernichtet, Tel Aviv und Haifa in Trümmern. Am Strand errichten die Vereinten Nationen Zeltlager für die wenigen überlebenden Juden.
„Und jetzt erwacht das Weltgewissen“, heißt es in Ephraim Kishons gespenstischer Satire Wie Israel sich die Sympathien der Welt verscherzte aus dem Jahr 1963. Nachdem Israel durch arabische Mächte ausgelöscht ist, wird den israelischen Flüchtlingen allerorts mit „größter Zuneigung und Bewunderung“ begegnet, und die UNO beschließt in einer „Gedächtnissitzung“, die israelische Fahne zur Erinnerung weiterhin hängen zu lassen.
An Gedenkrituale nach der Shoah erinnert diese politische Satire über den „leider“ gewonnenen Sinai-Feldzug 1956. 2024, 100 Jahre nach Ephraim Kishons Geburt, schwingt düster Dystopisches in dessen anspielungsreichen Pointen mit.
„Versöhnungsfigur“. Wie sehr der sensationell erfolgreiche Bestsellerautor nicht zuletzt auch von seinen Erfahrungen als Überlebender des Holocaust geprägt ist, weist die deutsche Literaturwissenschaftlerin Birgit M. Körner in ihrem neuen Kishon-Band nach, der vor allem das Phänomen der ungeheuren Beliebtheit des israelischen Humoristen im deutschen Sprachraum analysiert. Immerhin sind von einer Weltauflage von 43 Millionen Büchern allein 33 Millionen in deutscher Übersetzung gekauft worden.
Wieweit gerade diese Übertragungen, Nachdichtungen oder „Nachschöpfungen“ durch den Schriftsteller Friedrich Torberg für diesen gigantischen Erfolg verantwortlich sind, auch diese Frage verfolgt Körner. Galt doch lange die saloppe, von Torberg selbst genährte Meinung, die deutschen Fassungen seien „besser“ als das hebräische Original, das Torberg allerdings gar nicht lesen konnte, er übersetzte jeweils aus der englischen Fassung. Wichtig sei, stellte der Neffe der „Tante Jolesch“ fest, neben der Beherrschung der Sprache, in die man übersetzt, „auch noch eine Art Wesensverwandtschaft mit dem Autor“ des Originals. Und so wurde ihre auf dem gemeinsamen Kulturraum des alten Österreich und nicht zuletzt auf dem jüdischen Humor fußende „geistige Affinität“ von beiden immer wieder hervorgehoben.
Körner weist nun nach, inwieweit Torberg Kishons Satiren entschärft, ja zensuriert hat, etwa durch Streichungen von Aussagen zur NS-Zeit oder ganzer Textteile, die ihm nicht für sein zionistisch geprägtes Israel-Bild passend erschienen. Kishon für das deutschsprachige Publikum, das primär unterhalten werden bzw. mit den Juden über diese lachen wollte, leicht konsumierbar zu machen, war neben seinem Anliegen, mit den Büchern eine proisraelische Stimmung zu fördern, Torbergs vordringliches Bestreben. Mit dem so konstruierten und vermarkteten „israelischen Humor“ stieg Kishon in den 1960er- bis 1980er-Jahren zur „Versöhnungsfigur“ im Zeitgeist von „Wiedergutmachung“ und Philosemitismus auf.
Es gab einen Kishon für Touristen, für Steuerzahler, für Väter und Ehemänner, ja sogar einen „Kishon für Österreicher … und alle, die es gern wären“. Im Gegensatz zu Israel, wo er auch als Regimekritiker galt, war der Kishon für Deutsche aber unpolitisch, was auch bedeutete, dass ein Teil seines Werks gar nicht übersetzt wurde, um das positive Image des Humoristen nicht zu gefährden. Und so dienten Kishons Geschichten auch als „Entlastungsangebot“ für deutsche Lesende, um deren Schuldgefühle „im harmlosen Lachen über Juden und Jüdinnen in Israel aufzulösen“, wie einige Interpreten meinen.
„Ich spüre Genugtuung darüber, dass
die Enkel meiner Henker in meinen
Lesungen Schlange stehen.“
Ephraim Kishon
„Überlebensprinzip“. In seiner Autobiografie Nichts zu lachen erklärt Kishon den Humor als „Überlebensprinzip“, als Strategie für das geistige und psychische Überleben, wie er es in der Shoah erfahren hat. Am 23. August 1924 in Budapest als Ferenc Hoffmann in eine großbürgerliche jüdische Familie geboren, der Vater war Bankdirektor, ein Urgroßvater soll ein „Wunderrabbi“ gewesen sein, erlebte Ferenc schon als Jugendlicher antisemitische Diskriminierungen, konnte auf Grund des Numerus Clausus für Juden nicht studieren und wurde Goldschmied. 1944 wurde er wie alle Juden seines Jahrgangs zur Zwangsarbeit in der heutigen Slowakei eingezogen, 1945 gelang ihm die Flucht aus einem Transport nach Polen, der wohl in Auschwitz geendet hätte. Kishons Eltern und seine Schwester überlebten in Budapest, wo auch er dann bis Kriegsende untergetaucht war. Als russische Soldaten ihn gemeinsam mit anderen Zivilisten nach der Befreiung zur Zwangsarbeit in einen Gulag deportieren wollen, gelang ihm wiederum die Flucht. „Ich hatte einfach Glück“, resümiert er in seiner Autobiografie. Und: „Das Glück, das entscheidende Quäntchen Glück trennte die große verbrannte Mehrheit von der kleinen Minderheit der Überlebenden.“ Zeitlebens soll ihn eine Art „Überlebensscham“ belastet haben.

Birgit M. Körner: Israelische Satiren
für ein westdeutsches Publikum. Ephraim
Kishon, Friedrich Torberg und die Konstruktionen „jüdischen Humors“ nach
der Schoa. Neofelis 2024, 240 S., € 19,60
Wiedergeburt in Israel. Mit seiner ersten Frau Ewa gelangte er im Mai 1949 nach Israel und erhielt vom Einwanderungsbeamten in Haifa einen neuen Namen. Sein magyarisierter Nachname Kishont verlor das t und Ferenc – „Gibt es nicht“ – wurde kurzerhand zu Ephraim.
Bereits 1952 schrieb der junge Neueinwanderer in Hebräisch eine tägliche Kolumne für die Zeitung Maariv, und mit seiner ersten Sammlung von Humoresken Drehn Sie sich um, Frau Lot! gelang ihm 1959 auch der internationale Durchbruch als Satiriker des israelischen Alltags – ein Label, das auf seinem gesamten Werk haftet und ihn überlebte.
Nach dem Tod seiner zweiten Frau Sara, der „besten Ehefrau von allen“, heiratete Kishon, Vater dreier Kinder, 2003 die um Jahrzehnte jüngere österreichische Autorin Lisa Witasek und lebte mit ihr in der Schweiz, wo er Anfang 2005 verstarb.
Sein Wohnsitz in Afeka, einem Vorort von Tel Aviv, ist bis heute unverändert geblieben. Eine riesige Bibliothek, hunderte Ausgaben seiner Bücher in allen Sprachen, Auszeichnungen, Fotos, der Schachcomputer des leidenschaftlichen Schachspielers, eine Werkstätte für den Bildhauer, der er auch war, Manuskripte, Archivmaterial. Antisemitische Karikaturen, die er sammelte und sogar rahmte, weisen darauf hin, dass er dieses Kapitel aus seinem Vorleben keinesfalls vergessen wollte. „Dass die Enkel meiner Henker in meinen Lesungen Schlange stehen“, bereitete ihm Genugtuung.
Fast 20 Jahre nach seinem Tod erscheint die kleine menschelnde Welt Kishons, sein geliebtes Israel mit den ganz normalen Verrückten, wie eine Idylle aus einem gänzlich anderen, fernen Zeitalter. Und wie gerne würden wir mit ihm sagen, „Pardon, wir haben gewonnen.“