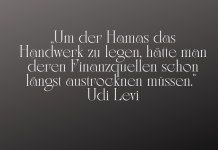Sie könnte schon ein Buch mit Dankschreiben von Persönlichkeiten aus Politik und Kultur füllen, angefangen von Karl Habsburg-Lothringen über Bundespräsident Heinz Fischer bis zur Bischofskonferenz. Die erforderliche finanzielle Unterstützung für ihre Projekte fiel dagegen ziemlich mickrig aus. Die Historikerin Ingrid Oberndorfer, gebürtig und wohnhaft in Grafenwörth, NÖ, widmet sich seit vielen Jahren der Erinnerung an jüdische Menschen und deren Schicksale sowie der Recherche nach vergessenen und aufgelassenen Friedhöfen im weiteren Umfeld ihrer Heimatgemeinde. „Leider spüre ich schon die Ablehnung gegenüber meiner freiwilligen Arbeit, nicht nur durch die Nachbarn, Mitmenschen, aber vor allem seitens der Behörden“, bedauert Oberndorfer, Jahrgang 1962. Erst wenn sie es schafft, ihr Anliegen in die Medien – vor allem auch in den ORF – zu bringen, bewegen sich die zuvor eher zögerlichen offiziellen Stellen.
Aber eine engagierte Einzelkämpferin gibt nicht auf: Daher konnte am 25. Juni 2010 ein Denkmal für die Retterin von vier jüdischen Menschen im Jahr 1944 in Grafenwörth eingeweiht werden. Obwohl die Hausfrau und Kriegswitwe Maria Grausenburger (1901–1973) bereits 1978 von Yad Vashem, der Holocaust-Gedenkstätte in Jerusalem, als Gerechte unter den Völkern ausgezeichnet wurde, erforderte es große Mühe, die mutige Mutter zweier Kinder in ihrem Heimatort zu ehren.
Wer war diese Frau, deren lebensgefährliche Tat so lange verschwiegen und verdrängt wurde? Maria Grausenburger war 1942 Kriegswitwe geworden. Im Herbst 1944 zogen auch in Grafenwörth ungarische Juden auf ihrem „Todesmarsch“ Richtung Mauthausen durch den Ort und ruhten eine Nacht auf dem Marktplatz aus. Unter den Geschundenen befanden sich Helene Weiss und deren Kinder Ernst, Tibor und Magda. Völlig erschöpft schlich sie mit ihren Kindern in eine Nebengasse und blieb auch am nächsten Tag dort.
Maria Grausenburger entdeckte die ausgehungerte Familie, versteckte sie im Keller ihres Hauses und gab ihr zu essen. Damit riskierte sie ihr eigenes und das Leben ihrer Kinder Elfriede und Heribert.
„Den Kindern und Enkeln von Helene Weiss war es sehr wichtig, dass Maria Grausenburger in ihrem Heimatort erinnert und geehrt wird.“
Ingrid Oberndorfer
Als eine Nachbarin etwas bemerkte und sie anzeigen wollte, schaffte es Grausenburger, diese davon abzuhalten. „Daraufhin ging sie zum Bürgermeister und bat ihn für ,die Ausländer‘, die ihre Pässe verloren hätten, neue Dokumente auf den unverfänglichen ungarischen Namen ,Varga‘ auszustellen“, erzählt Ingrid Oberndorfer.
Trotz aller Vorsicht wurden alle verraten. Der unerschrockenen Helferin geschah nichts, und da es keinen Beweis gab, dass es sich um Juden handelte, wurde Familie Weiss/Varga von einem bewaffneten Grafenwörther Nationalsozialisten in das Flüchtlingslager Gneixendorf abgeführt. In diesem Lager begannen die beiden künstlerisch begabten Buben Ernst und Tibor zu malen, unter anderem machten sie auch ein Porträt des Lagerkommandanten. „Diesem gefiel das Bild so gut, dass er zu Helene Weiss sagte: ‚Ja, was soll ich denn mit euch machen, die Zeichnung ist so schön.‘ Mutter Helene fasste sich ein Herz und bat ihn, sie mit ihrer Familie zu Maria Grausenburger zurückkehren zu lassen. Der Kommandant erlaubte dies unter der Bedingung, dass die beiden Buben arbeiten gehen. In Grafenwörth besorgte Maria Grausenburger den beiden Arbeit bei Bauern im Ort. Bis zum Einmarsch der sowjetischen Truppen drei Monate später konnte die Familie Weiss/ Varga bei ihrer Lebensretterin bleiben.
„Ich selbst habe bis 2010 nichts aus dieser Zeit über meinen Ort gewusst“, sagt Oberndorfer, „obwohl die geretteten Söhne immer wieder aus Israel hierher kamen und ihre Retterin besuchten. Die Heldentat von Grausenburger wurde nicht nur verschwiegen, im Gegenteil: Unbekannte legten ihr Glasscherben vor das Tor und haben ihr sogar vor den Eingang geschissen. Ihre einzige Sünde war, dass sie geholfen hat, aus dem System ausgebrochen ist – aber vor allem, weil sie etwas getan hat, was 99,9 Prozent nicht gemacht haben.“
Ingrid Oberndorfers Beiträge sind mir auf Facebook aufgefallen, doch wie wir dort zu „Freundinnen“ geworden sind, wissen wir beide nicht. Meine Aufmerksamkeit wurde geweckt, weil die Geschichtswissenschafterin laufend und fast ausschließlich Biografien, Jahrestags- und andere Erinnerungspunkte jüdischer Menschen postete, die weniger bekannt oder vergessen waren. Wer ist diese FB-Connection, die so bewegende und interessante Geschichten ausgräbt? Der Besuch bei Ingrid Oberndorfer in Grafenwörth hat sich gelohnt. „Nach der Matura in St. Pölten wollte ich unbedingt Geschichte studieren. Aber mein Geschichtslehrer, den ich sehr schätzte, fragte mich‚ ,was willst denn mit Geschichte? Studiere doch Jus.‘“
Bis heute verzeiht sie sich nicht, dass sie auf ihn gehört hat. Oberndorfer kommt aus einer Familie mit acht Kindern und arbeitete immer neben ihrem Studium in Wien, um ihrer Mutter finanziell helfen zu können. Trotzdem hatte sie ihren Traum vom Geschichtsstudium nicht verworfen. Als sie einen guten Job in einer Bank angeboten bekam, brach sie das Jusstudium ab. Nach einem längeren Aufenthalt als Troubleshooter in München, wo sie mehr als 60 Überstunden in der Woche leistete, überlegte sie, diese Überstunden in Wien für eine Studium neben der Arbeit zu nutzen. Sie kehrte zurück und begann ihr Studium der jüdischen Geschichte. Warum gerade das? „Durch Zufall bin ich mit einer Studienkollegin in eine Vorlesung an der Judaistik mitgegangen. Ich war so begeistert von der Materie, dass ich mein Studium in vier Jahren bei Klaus Lohrmann durchgezogen habe“, lacht die Frau Magistra. Ihre Diplomarbeit schrieb sie über jüdisches und adeliges Wirtschaftsleben im 14. Jahrhundert unter besonderer Berücksichtigung des Herzogtums Kärnten und seiner angrenzenden Länder.
Der Job bei einer Leasing-Bank belastete sie zunehmend, und so hat sich Ingrid Oberndorfer im Alter von 40 Jahren als Historikerin selbstständig gemacht und seither viele sehenswerte Projekte verwirklicht. Zum Beispiel hat sie bei der Aufarbeitung der Matrikel in der katholischen Pfarre auf 42 Seiten den Nachweis erbracht, dass bereits zwischen 1650 und 1750 Menschen aus über eintausend Orten in dieses Gebiet gezogen waren, vor allem nach dem Dreißigjährigen Krieg. „Auch Juden waren damals schon darunter, wir haben auf dem jüdischen Friedhof zwei Grabsteine aus 1670 gefunden“, so die akribische Forscherin. „Meine historischen regionalen Ideen wurden vom Land teilweise gefördert. Als ich mit den jüdischen Themen begonnen habe, ist das Interesse dann ebenso verschwunden wie zugesagte Förderungen.“
Oberndorfer erfährt ihren eigenen Worten nach „pausenlos Ablehnung“ auch in ihrer unmittelbaren Umgebung, wegen ihrer Themen. Aber auch Erfreuliches widerfährt ihr, wie zum Beispiel Plastiksackerl mit wertvollen Unterlagen und Hinweisen, die an ihrem Tor hingen.
Aktuelle Projekte und ein Vortrag im Mai. Oberndorfer, die sowohl mit der Israelitischen Kultusgemeinde wie auch mit dem Nationalfonds* laufend gut zusammenarbeitet, setzt ihre Erkundungen auf eigene Faust fort und findet immer noch Unentdecktes. „Im Bezirk Tulln, in der Ortschaft Micheldorf, tief im Wald, ist ein kleiner jüdischer Friedhof versteckt, dessen Steine in der NS-Zeit abgeschliffen und als Baumaterial verkauft wurden. Diesen Ort hat nicht einmal der Generalsekretär der IKG Raimund Fastenbauer gekannt. Ich habe mir Freiwillige gesucht und mit ihnen dieses total überwucherte Gebiet freigeräumt“, freut sie sich.
Am Sonntag, den 26. Mai 2024, hält die Historikerin einen Vortrag mit dem Titel Jüdisches Leben im Bezirk Gänserndorf: Schwerpunkt Deutsch-Wagram. In der Einladung von Oberndorfer heißt es u.a.: „Beim Vor trag auf dem Judenfriedhof erfahren Sie, wo es überall im Bezirk noch Nachweise jüdischer Kulturgüter gibt. Bis 1938 gab es auch einen Betsaal.“
Abgesehen von Vorträgen in Schulen und Volkshochschulen über jüdische Geschichte forscht die umtriebige Historikerin derzeit über jüdische Ärzte in Niederösterreich: „Es gab hier viele davon, auch Gemeindeärzte, die bereits ab 1900 Taufscheine vorweisen mussten.“ Sie plant zudem, eine Biografie über Maria Grausenburger zu schreiben. Und auch über die kleinen ehemaligen jüdischen Friedhöfe wäre eine Broschüre fällig.
Und wie ging es mit der Familie Weiss weiter? Helene kehrte mit ihren Kindern nach Ungarn zurück, um ihren Ehemann Kálmán zu suchen, doch 1946 erhielt sie die Gewissheit, dass er im KZ BergenBelsen ermordet worden war. Daraufhin wollte sie nach Palästina, wo ihr ältester Sohn lebte. Auf gefährlichen Wegen versuchte sie, illegal durch die Besatzungszonen nach Italien zu gelangen. Erst beim sechsten Versuch klappte es. Sie lebte und arbeitete mit den Kindern ein Jahr in Italien, um Geld für die Weiterreise zu sparen. Sie gelangten nach Zypern, wo sie sich wieder fast ein Jahr lang aufhielten. Erst 1948 konnten Helene Weiss und ihre Kinder in Israel einwandern. Einundzwanzig Nachkommen der Familie Helene und Kálmán Weiss leben heute dort.
„Den Kindern und Enkeln von Helene Weiss war es sehr wichtig, dass Maria Grausenburger in ihrem Heimatort erinnert und geehrt wird. Als ich wegen der Einweihung mit Marias Tochter sprach, sagte sie, ‚du weißt eh, dass sich der Enkel für die Großmutter schämt.‘ Ich konnte das kaum fassen und brachte Amir Roggel, Helenes Enkel aus Israel, und Marias Enkel Herbert in Grafenwörth gleich zusammen – jetzt ist alles bestens.“
* Der Fonds zur Instandsetzung der jüdischen Friedhöfe in Österreich wurde im Dezember 2010 eingerichtet, um die völkerrechtliche Verpflichtung Österreichs zur Restaurierung und Erhaltung bekannter und unbekannter jüdischer Friedhöfe in Österreich, die im Washingtoner Abkommen vereinbart worden war, umzusetzen. Dem beim Nationalrat eingerichteten Fonds wird über einen Zeitraum von 20 Jahren vom Bund jährlich ein Betrag in Höhe von einer Million Euro zugewendet; zudem sieht das Gesetz vor, dass die Eigentümer der jüdischen Friedhöfe für die Instandsetzungen Mittel in gleicher Höhe aufbringen.