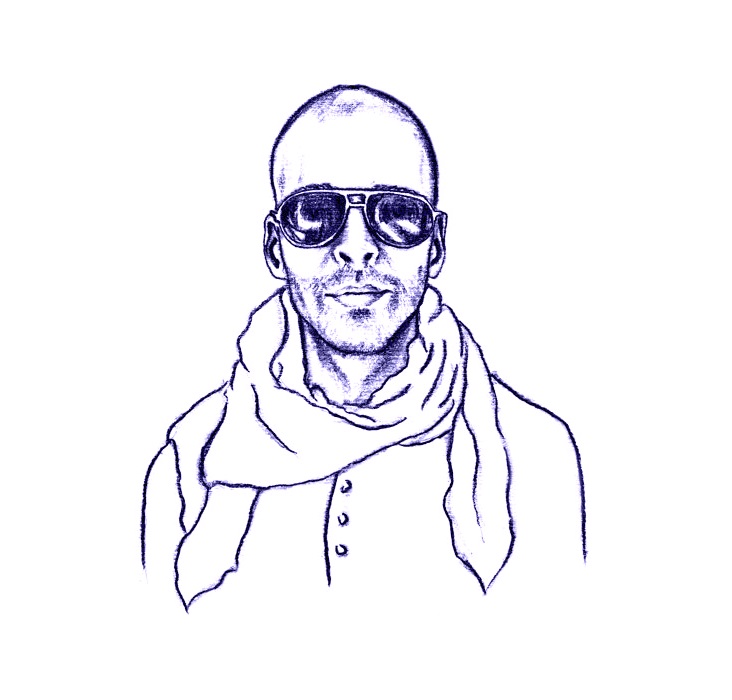Immer wieder erhalte ich Anrufe von einem Meinungsforschungsinstitut mit der Bitte, an einer Umfrage teilzunehmen. Bei Befragungen mit politischem Kontext wie zuletzt im Vorfeld der diesjährigen Arbeiterkammer-Wahl wird auch gerne der Punkt „Migrationshintergrund“ abgefragt. Das Kriterium dafür: Entweder man selbst oder die Eltern wurden nicht in Österreich geboren. Nun ist zwar mein Geburtsort Wien, aber meine Eltern kamen im Ausland zur Welt: mein Vater in Berlin, meine Mutter in Lissabon.
Jedes Mal, wenn in Medien Statistiken zitiert werden, die darlegen sollen, wie viel Prozent der Bevölkerung in Wien Migrationshintergrund haben, denke ich mir: Da bin ich nun mitgemeint. Aber bin ich wirklich mitgemeint? Haben jene Politiker, die unter Hinweis auf solche Statistiken vor „Überfremdung“ warnen, Menschen wie mich im Kopf? Vordergründig wahrscheinlich nicht. Die gängigen Feindbilder von heute bedienen eher Einwanderer und Geflüchtete aus Afghanistan, aus Syrien, Tschetschenien, Gambia, Nigeria oder dem Südsudan.
Dem Feindbild von vor 100 Jahren entspreche ich allerdings sehr wohl. Und wer verfolgt hat, wie sich seit dem 7. Oktober 2023, an dem Terroristen aus Gaza Israel überfielen und dabei Kinder, Frauen, Männer, ganze Familien, junge Feiernde, betagte Friedensaktivisten verletzten, quälten, niedermetzelten und entführten, in teils unfassbar hinterhältiger Manier der Hass weltweit über Juden und Jüdinnen ergießt, weiß: Unter der Oberfläche brodelt(e) da ganz viel, was nun unverhohlen wieder an die Oberfläche kommt. Zuletzt erschütterte mich neben all den Berichten über tätliche Angriffe wie etwa Anfang März ein Messerattentat auf einen Juden in Zürich, bei dem dieser schwer verletzt wurde, eine Meldung der Zeitung The Telegraph besonders, wonach sich inzwischen die Hälfte der britischen Verlage weigere, Bücher jüdischer Autoren und Autorinnen zu veröffentlichen. Da stehen wir also wieder.
1938 flüchteten meine Großeltern Marianne und Ernest Eichler zunächst von Wien nach Paris. 1940 wurde es auch dort eng, so ging die Reise weiter nach Südfrankreich. Doch in Bordeaux war zunächst Endstation, und zwar in einer zu einem Lager umfunktionierten ehemaligen Seilerei. Dank eines Visums des portugiesischen Konsuls Aristides de Sousa Mendes konnten sie schließlich nach einer Odyssee, die sie teils zu Fuß über die Pyrenäen führte, den sicheren Hafen Portugal erreichen, wo sie bis zum Kriegsende im Jahr 1945 in Caldas da Rainha untergebracht waren und dort auch bleiben mussten. Die jüdischen Geflüchteten waren geduldet, durften aber innerhalb Portugals nicht reisen.
Rechtzeitig vor der Geburt meiner Mutter war der Zweite Weltkrieg jedoch zu Ende – endlich konnten sich meine Großeltern in Lissabon niederlassen. Die prachtvolle Wohnung, die sich über die ganze erste Etage eines Hauses in der Gegend oberhalb der Praça Marquês de Pombal zog und in der die Familie schließlich für viele Jahre lebte, kenne ich nur aus den Erzählungen meiner Mutter. Diesen Februar sah ich mir zumindest die Fassade des Gebäudes an.
Eigene Erinnerungen verknüpfe ich jedoch mit der Wohnung in einem anderen Haus, wenige Gassen weiter, in der Rua Latino Coelho Nummer 39. Da sind die sehr verschwommenen und schemenhaften von einem Besuch bei meiner Großmutter (meinen Großvater habe ich nie kennen gelernt, er starb lange vor meiner Geburt) in einem Sommer in meiner Volksschulzeit Ende der 1970er-Jahre. Da sind die sehr klaren aus jenen vier Wochen, die ich im Sommer nach meiner Matura in Lissabon verbrachte. Und da sind die morbid-grotesken aus den 1990er-Jahren, als ich gemeinsam mit meiner Mutter nach Portugal reiste, um das seit Jahren unbewohnte Apartment – meine Großmutter hatte einen Schlaganfall erlitten und wurde nun in einem Sanatorium in Wien betreut – zu räumen.
Morbid-grotesk, denn wir hatten nichts von dem vorausgesehen, was uns schließlich erwartete: eine Wohnung, in der Strom und Wasser bereits abgestellt worden waren, in der sich der Staub wie eine Decke über alles gelegt hatte und es ekelhafte Geräusche machte, wenn wir auf einen der vielen aufgelegten Perserteppiche traten. Als wir sie anhoben, war da eine zweite Teppichschicht aus sich windenden Larven oder Würmern. Was für Tierchen das genau waren, weiß ich leider nicht. Smartphones waren noch nicht erfunden, auf die Idee, Fotos zu machen, kam ich damals nicht. Der erste Weg führte uns in den nächsten Supermarkt, um Wasserflaschen, Müllsäcke und Kunststoffhandschuhe zu besorgen. Tagelang sortierten wir dann Papiere, Kleidung, Hausrat, Bücher, Krimskrams aller Art, beschrifteten, was – zum Beispiel Möbel – schließlich vor Ort verkauft, was entsorgt, was einer Spedition zum Transport nach Wien übergeben werden sollte.
Bis heute freue ich mich über den Servierwagen im Bauhaus-Stil aus verchromtem Stahl, Glas und Holz, der nun in meinem Wohnzimmer steht. Der Holzrahmen der beiden Tablett-Ebenen war ursprünglich dunkelbraun, bis ich nach der Ankunft des Wagens in Wien selbst mit einem knalligen Blitzblau drüberstrich. Das war natürlich keine gute Idee. Jahre später ließ ich den Wagen restaurieren und das Holz dabei mit schwarzem Schellack politieren. So ist wieder ein Schmuckstückchen aus ihm geworden.

Die Wohnung meiner Großmutter, die mein 18-jähriges Ich in Erinnerung hat, war – sehr Wienerisch. Sobald man sie betrat, hätte man auch in einer x-beliebigen Altbauwohnung hierorts sein können. Die Bibliothek: hauptsächlich mit deutschsprachigen Bücher bestückt. Im Sommer 1989 las ich mich in den Wochen bei meiner Großmutter durch viele Klassiker der deutschen Literatur. Besonders hängen geblieben sind mir dabei Fräulein Else von Arthur Schnitzler und Der Tod in Venedig von Thomas Mann.
Noch einmal vor diesem außen grün gefliesten Haus zu stehen, war für mich einer der berührendsten Momente des heurigen Lissabon-Besuches. Als sich ein älterer Herr dem Haus näherte und dann tatsächlich vor der Eingangstüre stehen blieb und seinen Schlüssel herauskramte, war das so ein bisschen wie ein kleiner LottoMoment. Auf meine Frage, ob er sich an meine Großmutter erinnern könne, bejahte er, und es stellte sich heraus, dass es sich um den Hausherrn handelte, der seit seinen Kindertagen hier wohnt. So durften wir dann auch ins Entrée mit seinen vorrangig in Grün und Rosa gehaltenen Fliesen mit verspielten Blumenmotiven und das Stiegenhaus, das ich dünkler in Erinnerung hatte, was mir der Hausherr bestätigte. Er habe es vor ein paar Jahren rundum renovieren und neu gestalten lassen.
Rundum strahlend zeigt sich auch die einzige Synagoge Lissabons, die zweite Station unserer familiären Spurensuche. Sie wurde kurz nach 1900 im historistischen Stil erbaut und wird bis heute nach sephardischem Ritus geführt. Die Gemeinde existiert dagegen schon länger, und zwar seit rund 200 Jahren, wie die Guide, die ein israelisches Ehepaar und uns durch die Synagoge führte, erklärte. Damals hätten sich Juden und Jüdinnen, die zuvor in Gibraltar gelebt hätten, in Lissabon angesiedelt.
Dass meine Großmutter hierher gekommen ist, dürfte selten bis nie der Fall gewesen sein. Zu Jom Kippur wurde zwar gefastet, wie meine Mutter mir erzählte, doch selbst an diesem Tag hätten meine Großmutter und ihre Mutter, die hochbetagt 1971 in Lissabon starb, nicht die Synagoge aufgesucht, sondern den Tag zu Hause verbracht.
Und dennoch sollte vor allem für meine Tochter der Besuch der Sha’arei-Tikva-Synagoge eine große Portion Zuversicht vermitteln. Im kleinen Vorgarten hängen zahlreiche Tafeln an der das Grundstück umgebenden Mauer. Viele erinnern an verstorbene Funktionäre und Mitglieder der Gemeinde, einige an Politiker, die der Synagoge im Lauf der Zeit einen Besuch abgestattet haben. Und eine Tafel aus weißem Marmor mit goldener Schrift ist Aristides de Sousa Mendes gewidmet. „Konsul Portugals in Bordeaux 1938–1940“ steht da geschrieben, und „Huldigung der israelitischen Gemeinde von Lissabon“.
Als ich erzählte, dass sich auch meine Vorfahren durch von ihm ausgestellte Visa retten konnten, reagierte die Fremdenführerin sehr berührt. Bisher habe sie nur Angehörige von Menschen getroffen, die ebenfalls dank Sousa Mendes weiter flüchten konnten, für die Portugal aber nur ein kurzer Zwischenstopp auf der Reise in die USA oder anderswohin war. Dass geflüchtete Juden dann auch in Portugal blieben, wisse sie zwar, nur sei ihr bisher noch niemand aus solch einer Familie begegnet. Wohl deshalb erzählte sie in der Folge sehr ausführlich über Sousa Mendes, der entgegen der Anweisung des Diktators António de Oliveira Salazar Visa für vor den Nationalsozialisten Flüchtenden ausstellte und daher auch als Konsul abgesetzt und schließlich, zurück in Portugal, beruflich nicht mehr Fuß fassen konnte, da niemand mehr den Juristen beschäftigten wollte.
Hieran schloss sie auch ihren Bericht über die Art der Herrschaft von Salazar. Dieser werde bis heute von vielen als „milder Diktator“ gelabelt. Und ja, er habe im Zweiten Weltkrieg, wo sich Portugal neutral verhielt und so zu einer Drehschreibe von Diplomaten, aber auch Spionen wurde, keine Juden und Jüdinnen aus dem Land ausgewiesen und sie in Portugal, aber dann eben nur in dem zugewiesenen Ort, geduldet. Die Betroffenen hätten sich jedoch selbst erhalten müssen oder seien von Menschen privat unterstützt worden. Und er habe eben auch dafür gesorgt, dass recht rasch keine Einreisevisa mehr ausgestellt wurden. Auch das Regime Salazars sei gegen Kritiker des Staates brutal vorgegangen. Sie selbst, Anfang der 1980er-Jahren geboren, sei von ihrer Mutter als Kind immer noch darauf hingewiesen worden, dass man über manche Dinge nicht in der Öffentlichkeit spreche, denn man wisse nie, wer mithöre.
Wie es Menschen erging, die Widerstand gegen das Salazar-Regime leisteten, erfährt man heute im Aljube-Museum in Lissabon. Untergebracht in einem ehemaligen Gefängnis des Geheimdienstes PIDE erzählt das Museum vom Entstehen des „Estado Novo“ („Neuer Staat“), wie Salazar seine Form der Diktatur nannte, nach dem Ende der Ersten Republik durch einen Militärputsch 1926. Ab 1932 war Salazar Ministerpräsident, ein Jahr später trat die Verfassung des Estado Novo in Kraft. Zu bröckeln begann dieser Neue Staat ab dem Ende der 1950er-Jahre, als in den Kolonien – allen voran in Angola – Unabhängigkeitskämpfe ausbrachen. Zu Ende ging die Diktatur erst einige Jahre nach Salazars Tod 1970 mit der Nelkenrevolution im Jahr 1974. Im Aljube-Museum werden die Foltermethoden des Regimes detailliert geschildert, man sieht die sehr schmalen und klein dimensionierten Gefängniszellen, man erfährt von tausenden Ermordeten und der Verbringung von Festgenommenen in Lager in den Kolonien. Das Spitzelwesen war ausgeprägt, das Telefonieren keine sichere Kommunikationsform.
Warum blieben meine Großeltern auch nach 1945 in diesem als Diktatur organisierten Land, frage ich mich nun seit Wochen. Warum versuchten sie nach dem Krieg und der Geburt meiner Mutter nicht, weiter in die USA zu reisen, wo der Bruder meines Großvaters inzwischen lebte? Warum gingen sie nicht zurück nach Österreich? Antworten werde ich darauf nicht mehr bekommen. Dafür hat diese Reise Klarheit in anderen Punkten gebracht, die mich auch schon eine Weile beschäftigen. Da ist etwa die Frage: Was verbindet mich mit Portugal? Verbindet mich überhaupt etwas mit Portugal? Die Antwort: Abseits von einigen Besuchen und ein paar Anekdoten wenig.
Noch einmal vor diesem außen grün gefliesten Haus
zu stehen, war für mich einer der berührendsten Momente des heurigen Lissabon-Besuches.
Die Anekdote, die mich wohl am meisten betraf: Ich war Anfang der 1980er-Jahre für kurze Zeit portugiesische Staatsbürgerin. Es hatte sich durch eine Gesetzesänderung die Möglichkeit ergeben, um die Staatsbürgerschaft anzusuchen, und meine Eltern dachten sich, nicht zuletzt wegen der Ereignisse während der NS-Zeit, dass es immer für etwas gut sein könne, einen weiteren Pass zu haben. Dunkel erinnere ich mich, wie es damals war, das Dokument auf der portugiesischen Botschaft abzuholen, und dass es sich merkwürdig anfühlte, weil ich doch kein Portugiesisch sprach. Aber so war es eben.
Das Erwachen kam, als wir am Anfang meiner Gymnasialzeit vom Schifahren in den Semesterferien zurückkamen. Da war nämlich die Verständigung eingetrudelt, dass meinem Bruder und mir wegen der Annahme der portugiesischen Staatsbürgerschaft die österreichische Staatsbürgerschaft aberkannt worden war. Nun war Feuer am Dach. Wir gaben den portugiesischen Pass zurück, und es habe, so die Familienerzählung, meinen Vater eine Stange Geld gekostet, das wieder geradezubügeln.
Worüber meine Art von Migrationshintergrund erzählt: von den Brüchen, die der Nationalsozialismus jüdischen Familien zufügte. Ja, die erzwungene Flucht ist auch eine Art von Migration. Und die Rückkehr meiner Mutter nach Österreich viele Jahre später ebenfalls. Meine Großmutter war aber ebenso wie ihr Bruder und dessen Frau, die ebenfalls in Portugal überlebten und dann auch dort blieben, viel österreichischer als meine deutsche Großmutter, die, obwohl sie Jahrzehnte in Österreich lebte, nie ihren deutschen Akzent verlor. Meine Lissaboner Großmutter kochte wunderbare Marillenknödel (mit Wiener Würfelzucker, das war die wichtigste Zutat). Sie liebte es, Wienerlieder zu singen. In ihrer Speis in der Wohnung in der Rua Latino Coelho hortete sie MannerSchnitten. Und sie blieb auch österreichische Staatsbürgerin und suchte niemals um die portugiesische Staatsbürgerschaft an. Zu Hause wurde zudem immer Deutsch gesprochen, erzählte mir meine Mutter. Nachsatz: „Sie hielten immer die Kultur hoch vom Land, das sie nicht wollte.“
Portugal ist für mich positiv besetzt, weil es meiner Familie einen sicheren Hafen bot. Aber mehr Emotionen sind da nicht. Oft stellen sich Menschen, vor allem, wenn sich Umbrüche der Regierungskonstellation abzeichnen, die Frage, wohin man heute im Fall des Falles flüchten könnte. Die Mitgliedschaft in der EU macht es inzwischen leichter, sich zumindest in Europa einen neuen Wohnort zu suchen. Im Hinterkopf war bisher immer dieses Gefühl: Wenn alle Dämme brechen, ist Portugal stets eine Option.
Nach dem letzten Besuch bin ich mir allerdings nicht mehr so sicher. Lissabon ist eine pittoreske Stadt, das Meer ist nah, das Klima mild, und auch die Fliesenkunst, auf so vielen Häusern zu finden, hat es mir angetan. Die Küche hat für jene, die keinen Fisch und kein Fleisch essen, allerdings wenig zu bieten. Man kann sich ja auf lange Sicht nicht ausschließlich von Pasteis de nata und anderem Gebäck ernähren. Barrierefreiheit ist in den öffentlichen Verkehrsmitteln, aber beispielsweise auch in Museen nicht gegeben. Die Stadt ist hügelig, die gepflasterten Gehsteige sind in einem teils schlechten Zustand. Ich verstehe zwar ein paar Brocken Portugiesisch, spreche es aber nicht. Ja, klar, wenn man vom Tod bedroht wird, ist das alles egal. Da zählt nur das sichere Überleben.
„Warum blieben meine Großeltern
auch nach 1945 in diesem als Diktatur
organisierten Land, frage ich mich nun seit Wochen.“
Alexia Weiss
Aber es ist immer und immer wieder das Reisen, das mir so viel Freude macht, das mir allerdings auch zeigt, wie sehr ich Wien liebe. Und wenn dann hierzulande wieder über den einen U-Bahn-Aufzug, der wegen einer Reparatur für kurze Zeit nicht funktioniert, oder die Baustelle, weil ein neuer Radweg errichtet wird, gemotschkert wird: Wien ist eine wunderbar verwaltete Stadt mit einer öffentlichen Infrastruktur, die international ihresgleichen sucht.
Was mich bei diesem Lissabon-Besuch allerdings am meisten deprimiert hat, war der Besuch des jüdischen Friedhofs. In bewohntem Gebiet gelegen und von Häusern umgeben, drängt sich Grab an Grab, Grün sucht man hier vergeblich. Es ist ein sephardischer Friedhof – stehende Grabsteine gibt es hier keine, ein ungewohnter Anblick, wenn ich ihn mit den jüdischen Friedhöfen in Österreich, in Polen, in Prag vergleiche. Hier verraten Inschriften auf den am Boden liegenden Grabplatten, wer darunter ruht.
Wir haben Glück an diesem Tag, es ist ein älterer Mitarbeiter vor Ort, mit dem wir uns via Übersetzungsprogramm am Smartphone schließlich gut verständigen können. Er hilft uns, das Grab meines Großvaters und auch das meiner Urgroßmutter zu finden. Beklemmend empfinde ich, dass es kaum möglich ist, dabei nicht auf andere Gräber zu treten. Wege zwischen den Grabreihen sind hier mangels Platz nicht vorgesehen.
Was überrascht: Die Grabinschriften auf beiden Gräbern sind in Iwrit – und in Deutsch. „Hier ruht Eugenie Weiss geb. am 16-7-1875 gest. am 12-11-1971 betrauert von ihren Kindern und Enkeln“ steht da auf dem Grab meiner Urgroßmutter. Der Stein auf dem Grab meines Großvaters ist verwitterter und nur mehr schlecht zu entziffern. Es ist ihm aber noch zu entnehmen, dass er 1910 in Wien zur Welt kam und 1963 in Lissabon verstarb. „Ruhe in Frieden“ ist zudem zu lesen. Wie friedvoll kann man ruhen, wenn immer wieder Menschen auf das Grab steigen müssen, um ein anderes besuchen zu können, denke ich mir. Wir hinterlassen einen Stein auf dem Grab meines Großvaters, den ich nie kennengelernt habe, von dem ich aber weiß, dass meine Mutter sehr an ihm hing. Bis heute erzählt sie immer wieder von schönen Erinnerungen an ihn. Ich denke, den Stein habe ich vor allem deshalb hingelegt, um dieser ganzen Szenerie ein bisschen an Trostlosigkeit zu nehmen.
Meine Tochter hinterließ dieser Friedhof weniger niedergeschlagen als mich. Er sei angenehm ruhig und strahle trotz allem etwas Friedvolles aus, meinte sie. Sie hatte zuvor schon den Synagogenbesuch ungewohnt positiv resümiert. Schön sei es zu wissen, dass es eben auch die guten Menschen gebe, die wüssten, dass ihr Handeln für sie selbst negative Konsequenzen haben könnte, und die dennoch das Richtige tun. Wie Sousa Mendes im Jahr 1940, der schließlich 1954 ohne öffentliche Anerkennung zu seinen Lebzeiten verarmt verstarb. 1966 wurde er von Yad Vashem als „Gerechter unter den Völkern“ anerkannt. Erst 1988 wurde Sousa Mendes vom portugiesischen Parlament rehabilitiert.