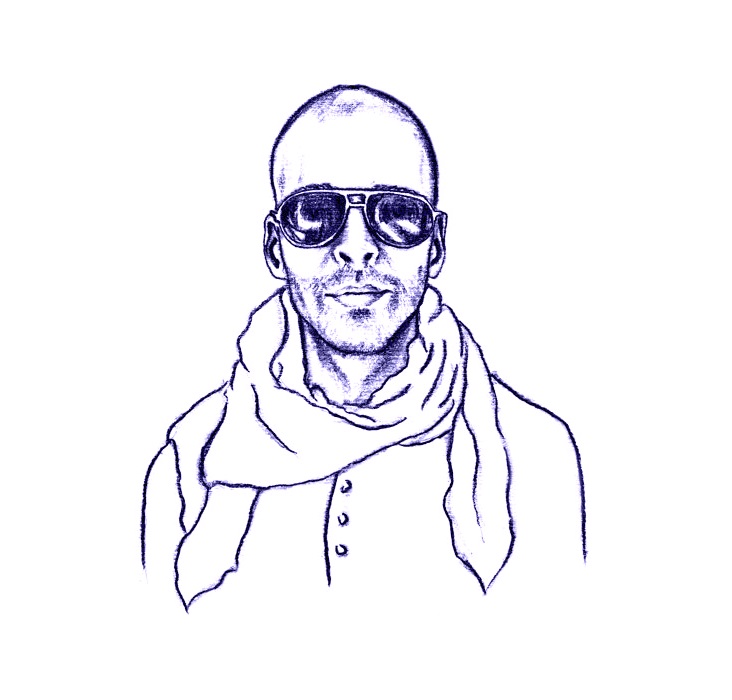WINA: Politisch engagiert im höchsten Maß warst du als Zeitgenosse und Schriftsteller immer schon. Seit dem 7. Oktober und seinen Folgen wirst du aber medial quasi als betroffene Instanz befragt. In einem „Theaterabend“ hast du nun Trauerarbeit und Diskussion in einem Mosaik aus Aussagen von Geiseln vereint, dem du einen eigenen Text voranstellst. Was war die Motivation für diese Arbeit? Doron Rabinovici: Ich habe bis zum 7. Oktober versucht, einen Roman zu schreiben. An diesem Tag war ich in der Schweiz, als die Nachrichten auf uns einströmten, und als ich das israelische Fernsehen zuschaltete, konnte ich nicht fassen, was ich sah. Ab diesem Moment sah ich mir all das an, was ich gleichzeitig anderen empfahl, auf keinen Fall anzusehen, mit dem Bewusstsein, dass ich das machen muss. Ich merkte, was alles gescheitert und was menschlich hier passiert war, hörte zugleich den Antisemitismus und wusste, wenn wir im Moment der Schwäche als Opfer dastehen, würden wir nicht auf Mitleid treffen, im Gegenteil. Mir war klar, an dem Roman arbeite ich nicht weiter, sondern setze mich damit auseinander. Ich war erstaunt, wie wenig an zivilgesellschaftlicher Empathie sich zeigte und wie sehr von Anfang an vorweggenommen wurde, was wir später an Vorwürfen gegen Israel erfuhren. Als das Burgtheater an mich herangetreten ist, wollte ich keine literarische Collage machen, weil ich fand, dass das dem Geschehen nicht gerecht wird, sondern schlug eine Collage aus Zeugnissen Überlebender vor. Als ich im Dezember nach Israel fuhr, fand ich es anfangs obszön, die Orte der Verbrechen aufzusuchen, aber mein Bruder, der in Israel lebt, und meine Frau meinten, ich müsse unbedingt hinfahren. Ich habe dort schließlich befreite Geiseln, Überlebende und deren Verwandte getroffen und bin mit mehr als drei Stunden Material zurückgekommen, was natürlich zu viel war. Das Burgtheater meinte, dass noch etwas Erklärendes erforderlich wäre, und so habe ich einen Prolog als Auftakt dazugeschrieben.
Wie kam es zur Auswahl der Texte, wie weit sind diese bearbeitet und nach thematischen Gesichtspunkten geordnet worden?
I Ich habe zunächst drei Personen interviewt, aber viele Zeugnisse waren auch schon im Netz. Dramaturgischliterarisch bearbeitet man das Material, indem man die Texte rafft und kürzt. Thematisch beginnt es mit WhatsApp-Nachrichten aus den Kibbuzim und den Schilderungen dessen, was an Schrecklichkeiten geschah, geht dann weiter mit Aussagen derer, die noch nicht darüber hinweg sind, und endet mit Menschen, die trotzdem immer noch hoffen. Mir war daran gelegen, dass es universalistisch, also etwas Einmaliges nicht nur für Israel, sondern für uns Menschen an sich sein sollte. Wir haben ja keinen Begriff für dieses von langer Hand geplante Verbrechen. Das war kein Pogrom, keine Massenvernichtung, auch keine Terrorattacke, wir werden auch keinen Begriff dafür haben, vielleicht bis der Konflikt gelöst ist und wir gemeinsam einen Begriff dafür finden. Wir sind noch nicht danach. Während hier viele so tun, als hätte der 7. Oktober gar nicht stattgefunden, ist er in Israel noch gar nicht vorbei. Weil die Geiseln noch nicht befreit sind und die Ungeheuerlichkeiten der Hamas, aber auch das Debakel der Regierung noch nicht beendet sind.

Bereits mit den Letzten Zeugen und später mit Alles kann passieren, einem bizarren Mosaik aus Zitaten rechter Politiker, hast du formal mit Originaltexten beeindruckende Bühnenevents gestaltet. Was ist jetzt, nachdem auch das Unvorstellbare passiert ist, qualitativ anders?
I Man könnte vermuten, dass ich eine Art dokumentarisches Theater mache, das ist nicht der Fall. Bei dem ersten und jetzt dem dritten Projekt ist der Respekt vor den Überlebenden maßgeblich, und da braucht es keine Theatralik. Es gibt aber große Unterschiede, denn für unsere Eltern war das Geschehen vorbei, und auf der Bühne zu stehen, bedeutete ihnen eigentlich eine Therapie (Dorons Mutter Schoschana Rabinovici war eine der Letzten Zeugen am Burgtheater, Anm.). Möglicherweise hätte es für die Überlebenden des Nova-Festivals und der Kibbuzim auch etwas Therapeutisches, aber die Gefahr, dass sie so etwas gar nicht durchstehen, ist groß, denn auf der Bühne zu stehen, während Schauspieler:innen deine Geschichte erzählen, ist schwer. Auch wollten wir keine Wiederholung von etwas Einzigartigem. Es heißt oft, das ist jetzt eine Retraumatisierung, natürlich ist es das auch, aber es ist vor allem eine eigene Traumatisierung.
Was kann, was soll ein solcher singulärer Abend bewirken?
I Zu hoffen wäre, dass es nicht einmalig bleibt, sondern wir auch andere Veranstaltungen in Deutschland haben werden, vielleicht auch in Wien, und da besteht bereits Interesse.
Wir alle leben besonders jetzt vermehrt in unseren ideologischen Blasen, spinnen uns mehr oder minder in unseren Positionen ein. Wie kann man mit einem solchen Projekt diese Blasen aufsprengen und darüber hinaus wirksam werden?
I Das wird passieren, denn die Theater, die das aufführen, werden auf Widerstände stoßen. So etwas findet auch gegen den Willen vieler, die das verleugnen, statt. Es wurde ja wiederum ein Verbrechen an jüdischen Menschen verübt, das wieder zugleich verleugnet, bestritten und gefeiert wird. D. h. es wird gesagt, die Juden haben das erfunden und sie seien mächtig genug, diese Lüge zu verbreiten. Die Erinnerung an das, was passiert ist, und dass man trauern möchte, sind ein Thema, das am Theater so alt ist wie Sophokles mit seiner Antigone – dieses Thema hat eine neue Aktualität gefunden, weil wir ja die Kreone herumrennen haben, die fordern, der israelische Pavillon in Venedig soll nicht da sein, der israelische Autor soll nicht übersetzt werden. Insofern glaube ich schon, dass dieses Projekt seine eigene Wirkung über die Blase hinaus entfalten wird.
„Ich erlebe antisemitische Äußerungen,
seit ich denken kann.“
„Ich muss mich dem Grauen aussetzen“, hast du in einem Interview von dir selbst gefordert. Nun sind kürzlich du und deine Frau sogar auf offener Straße antisemitisch angegriffen worden, vorerst verbal. Was macht das mit einem?
I Gar nichts, denn ich erlebe antisemitische Äußerungen, seit ich denken kann, ich habe schon in der Schule damit zu tun gehabt. Schlimmer ist, dass Menschen, die einem nah sind, schon bald nach dem 7. Oktober kein Verständnis dafür hatten, dass Israel gezwungen ist, auf die Hamas zu reagieren. Für mich war klar, dass es falsch ist, kein Kriegsziel zu haben, aber einen Kriegsgrund konnte ich nennen.
Quasi als Anwalt für ein besseres Israel und als Wiener Jude gegen den Antisemitismus einzutreten, bringt auch Verantwortung mit sich. Wie gehst du damit um?
I Ich sage, was ich mir denke, als Individuum, aber als jüdisches Individuum, und ich bin mir bewusst, dass derselbe Satz in Israel gesprochen etwas anders bedeutet, als wenn er hier gesprochen wird.
Wir alle haben mehrere Identitäten. Von der Umgebung nur auf eine, die als Jude, als Jüdin zurückgeworfen zu sein, wird man als Einengung erleben.
I Aber wenn man als Jude angegriffen wird, muss man sich als Jude verteidigen, wie Hannah Arendt gesagt hat. Wenn aber ein anderer angegriffen wird in seinem Menschsein, dann ist es notwendig, sich als Mensch zu äußern. Ich verleugne weder meine jüdische Herkunft, noch lasse ich mich als Geisel nehmen. Auf keinen Fall akzeptiere ich, dass im Namen der Gemeinde Fragen nicht mehr gestellt oder Dinge nicht ausgesprochen werden dürfen. Innerjüdisch bin ich für eine offene Debatte, aber nach außen bin ich härter, weil ich glaube, dass es tatsächlich etwas anderes bedeutet, ob manche Dinge von einem Nicht-Juden gesagt werden oder von einem Juden. Ich stehe zum Staat Israel, nicht aus Loyalität, sondern weil es meine Meinung ist, dazu brauche ich keine Flaggentreue.
„Wir haben ja keinen Begriff für dieses Verbrechen.“
Als prominenter österreichischer Jude bist du jetzt gefordert, und als Schriftsteller zahlst du wohl einen Preis. Du kannst dich, schon aus Zeitgründen, weniger deiner literarischen Arbeit widmen.
I Als Jude in Österreich ist man natürlich gefragt, dem entkommt man nicht. Den Preis habe ich aber immer schon gezahlt, auch als ich als Antirassist gegen Schwarz-Blau eingetreten bin. Ich versuche durch mein Schreiben dagegen zu rebellieren. Ich empfinde meinen Prolog auch als literarische Arbeit, und ich schreibe gerade an einem Buch, das mit dem Satz beginnt: „Was hatte ich dort verloren“. Darin geht es um meine Reise zu den Orten des Massakers.
Wir leben in einer Zeit, in der Schlagworte von allen Seiten Konjunktur haben, und erleben, dass sie auch schlagend werden, also in Taten umschlagen können. Abrüstung der Worte wird oft gefordert. Wie gehst du als Autor, dessen Material ja die Sprache ist, damit um, dass Worte auch Munition sein können?
I Das ist die schriftstellerische Arbeit. Indem ich darauf hinweise, welche Sprengfallen Sprache in sich trägt, und indem ich zur Sprache bringe, wo es sie uns verschlägt. Dieser Konflikt unterscheidet sich von anderen Auseinandersetzungen, denn wenn im Nahen Osten geschossen wird, dann kann überall auf der Welt eine Jüdin, ein Jude getroffen werden. Das gibt es bei keinem anderen Konflikt.
Ich persönlich bin jetzt oft froh, dass meine Eltern den derzeitigen Zustand Israels und die neuerliche Bedrohung der Juden nicht mehr erleben müssen. Wie sollen wir in der Diaspora mit unseren Ängsten umgehen, was sagen wir der nächsten Generation?
I Ich versuche darzustellen, dass das Ressentiment und der Hass auf Schwäche durch noch mehr Wut reagieren, und nichts hasst der Todfeind des Jüdischen mehr als den unsichtbaren Juden, den er überall vermutet. Deshalb geht es darum, sich nicht wegzuducken, aber auch darum, offen und kritisch zu bleiben. Das, was unsere Eltern uns gesagt haben, nämlich sich zu wehren, das natürlich auch, prinzipiell aber sich nicht zu verstecken. Und auch darüber nachzudenken, was jüdisch sein kann, denn das hat viele Gesichter, und ich möchte das nicht einschränken. Ich möchte natürlich meine jüdisch geprägte Meinung ganz klar sagen. Ich glaube, diese Haltung ist auch bei den jetzigen jüdischen Jugendlichen sehr stark vertreten. Sie sind solidarisch, sie bilden Allianzen, sie denken an die anderen Verfolgten, sie sind gegen Rassismus, aber sie nehmen ganz klar ihren Standpunkt ein, wenn sie auf Antisemitismus treffen.